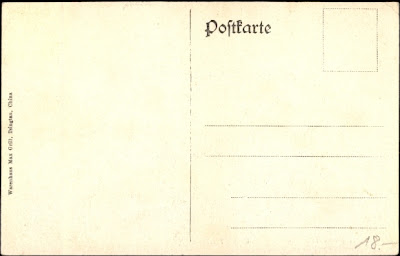19.11.2011
Tsingtau/Kiautschou Jahrhundertwende


Kiautschou als deutscher Pachthafen [Bearbeiten]
Die Verwaltung unterlag nicht dem deutschen Kolonialamt, sondern dem Reichsmarineamt. 1898 wurde eine deutsche Postagentur eingerichtet. 1899 bestand eine 14-tägliche Postdampferverbindung nach Shanghai. Die Kolonie wurde zu einem Vorzeigebeispiel deutscher Kolonialpolitik: 1914 zählte die Hauptstadt der Kolonie, das ehemalige FischerdorfTsingtao, über 200.000 Einwohner, verfügte über einen Naturhafen, Trinkwasseranlagen, dieBrauerei Tsingtao, seit 1909 eine Universität und war an das Telegraphen- und Eisenbahnnetzangeschlossen. Seit Fertigstellung der Eisenbahnlinie Tsingtao–Tsinan 1904 war Kiautschou über die Transsibirische Eisenbahn von Deutschland aus zu erreichen, die Reisezeit betrug circa 13 Tage.
In weiten Teilen der deutschen Öffentlichkeit waren große Erwartungen an den Erwerb Kiautschous geknüpft worden. Sie reichten von der Öffnung des riesigen chinesischen Marktes für den deutschen Handel über die maritime Weltgeltung bis hin zur Entstehung eines glanzvollen Kolonialreiches. In der Realität konnten diese Erwartungen in der kurzen Zeit des Bestehens der Kolonie 1898–1914 nicht erfüllt werden. Kiautschou selbst erwies sich sehr schnell als ein finanzielles Fass ohne Boden: In den ersten zehn Jahren nach 1897 beliefen sich die Reichszuschüsse auf 100 Millionen Reichsmark, die Einnahmen erreichten nicht einmal ein Zehntel.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs [Bearbeiten]
Hauptartikel: Belagerung von Tsingtau
Kiautschou war zu Beginn des Ersten Weltkriegs durch das III. Seebataillon besetzt (1400 Mann), das bei Kriegsbeginn durch 3.400 Mann verstärkt wurde. Am 10. August 1914 stellte Japan ein Ultimatum, in dem die vollständige Übergabe des Gebietes verlangt wurde. Am 15. August wiederholten sie ihre Forderung. Der Gouverneur, Kapitän zur See Alfred Meyer-Waldeck, ließ das Ultimatum unbeantwortet und war fest entschlossen, das Pachtgebiet „bis zum Äußersten zu verteidigen“.
Am 27. August eröffneten japanische und britische Kriegsschiffe eine Blockade, und bereits am 2. September landeten die ersten Alliierten (4300 Mann) in China. Am 26. September begannen Sturmangriffe auf die deutschen Stellungen, die jedoch erfolgreich zurückgeschlagen werden konnten. Nach den erfolglosen Angriffen zogen die Alliierten einen Belagerungsring um die Festung, so dass das Pachtgebiet bis zum 28. September komplett eingeschlossen war. Seit Oktober wurden die alliierten Truppen ständig verstärkt bis auf schließlich über 60.000 Mann. Am 31. Oktober, nach einem neuntägigen Artillerie-Dauerbeschuss, begannen die Alliierten einen großangelegten Angriff auf die Festung, der wiederum abgewehrt werden konnte. Die zunächst erfolgreiche Verteidigung basierte zum Teil auf der erfolgreichen Luftaufklärung durch den Marineflieger Gunther Plüschow, der als Der Flieger von Tsingtau bekannt wurde.
Anfang November ging den eingeschlossenen deutschen Verteidigern die Munition aus, worauf man sich entschloss, sämtliche Artillerie und Kampfboote zu vernichten. Am 7. November 1914 erfolgte schließlich die Kapitulation und die Besetzung durch Japan.
Die deutschen Verteidiger wurden nach Japan in Kriegsgefangenschaft verbracht. Sie lebten dort in mehreren Lagern und wurden teilweise erst 1920 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Die bekanntesten Lager hießen Matsuyama und das Kriegsgefangenenlager Bandō.
Nach dem Ersten Weltkrieg [Bearbeiten]
Durch den Versailler Vertrag wurde bestimmt, dass Deutschland alle Kolonien und damit auch Kiautschou abzutreten hatte. Bis 1922 blieb das Gebiet unter japanischer Verwaltung, bevor es auf Drängen der USA an China zurückgegeben wurde. Die Bestimmungen des Versailler Vertrages hatten im Jahr 1919 heftige Studentenproteste in China zur Folge. Diese Proteste sind als Bewegung des 4. Maibekannt und hatten weit reichende Folgen für die chinesische Kultur und Gesellschaft.

Qingdao oder Tsingtau war seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ein deutscher Kolonial-Handelsstützpunkt. Bestrebungen, im ostasiatischen Raum einen Stützpunkt (reiche Steinkohlenlager sollten erschlossen werden) zu besitzen, lassen sich inPreußen bis in das Jahr 1859 zurückverfolgen, als dort erstmals ein Geschwaderder preußischen Marine operierte. Handels- und Marinekreise waren seit der Öffnung Chinas in den Opiumkriegen daran interessiert, dem deutschen Chinahandel den notwendigen militärischen Rückhalt zu verschaffen, ohne den deutsche Kaufleute nur schwer hätten Fuß fassen können. Auch andere Staaten, darunter Großbritannien, Russland und Frankreich, schufen sich zwischen 1842 und 1899 Handelsstützpunkte in China.
1896 beschloss die Reichsregierung, den Erwerb eines Stützpunkts aktiv zu betreiben. Ein Übergriff auf deutsche Missionare, bei dem zwei von ihnen getötet wurden, bot den Anlass, ein Kreuzergeschwader der Kaiserlichen Marine unterKonteradmiral Otto von Diederichs zu entsenden und China ein Ultimatum zur Überlassung eines Pachtgebiets zu stellen. Angesichts der militärischen Übermacht gab China nach. Ein Pachtvertrag auf 99 Jahre wurde am 6. März 1898 unterzeichnet. (siehe: Kanonenbootpolitik)
Von 1897 bis 1914 stand Qingdao als Hauptstadt des „Deutschen Schutzgebiets Kiautschou“ unter deutscher Herrschaft. Aus dieser Zeit sind viele Bauten erhalten, so zum Beispiel eine Brauerei, ein Bahnhof, eine protestantische Kirche sowie die Residenz des Gouverneurs. Der bauliche Bestand sowie das Leben der Einwohner wurden erstmals 1903-1906 fotografisch von Friedrich Behme dokumentiert. West-Shandong war einer der Schauplätze des Boxeraufstandes von 1900, in dem versucht wurde, die Kolonialherren aus China zu vertreiben. 1913 bestand die Stadtbevölkerung aus 53.312 Chinesen, 2.069 Europäern und Amerikanern, 2.400Soldaten der Garnison, 205 Japanern und 25 anderen Asiaten.
Nach Beginn des Ersten Weltkriegs, am 7. November 1914, wurde Qingdao nachdrei Monaten Belagerung von Japan besetzt. 5.000 Deutsche leisteten Widerstand, der jedoch gegen die Übermacht von 30.000 Japanern nicht zu halten war. DasOstasiengeschwader befand sich bei Kriegsbeginn in der Südsee. Daraufhin strömten japanische Kaufleute und Gewerbetreibende in die Stadt. Es entstand ein Japanerviertel, in dem 1920 bereits 17.597 Japaner lebten, die wie die Deutschen den Ehrgeiz hatten, eine „Musterkolonie“ aufzubauen.
Die deutschen Verteidiger wurden nach Japan in Kriegsgefangenschaft verbracht. Sie lebten dort in mehreren Lagern und wurden teilweise erst 1920 aus der Kriegsgefangenschaftentlassen. Die bekanntesten Lager hießen Matsuyama und das Kriegsgefangenenlager Bandō.
Entsprechend den Bestimmungen des Versailler Vertrages blieb die Kolonie zunächst in japanischer Hand. Die Rückgabe an China erfolgte erst am 10. Dezember des Jahres 1922. In der Folgezeit führten die bürgerkriegsähnlichen Zustände der Kriegsherren-Epoche zu wirtschaftlicher Stagnation.
Unter nationalchinesischer Regierung und nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten die USAQingdao zeitweise als Flottenbasis. Dies fand 1949 ein Ende, nachdem die Stadt von den chinesischen Kommunisten eingenommen worden war.[4]
http://de.wikipedia.org/wiki/Tsingtau









Zitat aus „Kolonie und Heimat“:
„Unsere ostasiatische Kolonie ist, wie wir gesehen haben, kein selbständiges Wirtschaftsgebiet. Das Land, das wir von den Chinesen gepachtet haben, hat in seiner Kleinheit an sich einen geringen Wert. Wertvoll ist es erst dadurch geworden, dass wir es durch unsere Verkehrsanlagen zum Ein- und Ausfuhrhafen des Hinterlands, der Provinz Schantung, gemacht haben. Tsingtau ist also - abgesehen von seiner Eigenschaft als Flottenstation - zunächst Handelsplatz, wird aber voraussichtlich mit der Zeit, wenn sich die Provinz Schantung mehr entwickelt hat, auch Industrieplatz werden. Dieser Entwicklung sucht man schon heute durch geeignete Massnahmen den Boden zu bereiten. In erster Linie dadurch, dass man das Pachtgebiet am 1. Januar 1906 an das chinesische Zollgebiet angegliedert hat. Früher fand die Verzollung der Einfuhrwaren erst an der Landesgrenze statt. Jetzt ist nur noch das engere Gebiet des Grossen Hafens Freihafenbezirk, und die Verzollung erfolgt schon am Hafen. Damit wird bezweckt, industriellen Unternehmungen in unserer Kolonie, welche die Rohstoffe des Hinterlandes verarbeiten und ihre Produkte auch dort wieder absetzen wollen, den Zoll zu ersparen. “
– KOLONIE UND HEIMAT. Eine Reise durch die Deutschen Kolonien, VI. Band - Kiautschou. Herausgegeben von der illustrierten Zeitschrift „Kolonie und Heimat“. BERLIN,, ,KOLONIE UND HEIMAT“ Verlagsgesellschaft m.b.H, 1912
Kiautschou, der „Platz an der Sonne“, kostete das Deutsche Reich jährlich Millionensummen. Eine positive Handelsbilanz erreichte das Gebiet nie.

25.01.2011
30.12.2010
Pillau / Badeort wie Marinestützpunkt


Die Reichsregierung befürchtete in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg Unannehmlichkeiten für Fahrgäste, Post und Güter zwischen den beiden Reichsteilen auf dem Landweg durch Polen. Bei Sperrungen des Eisenbahn-Korridorverkehrs war der Seedienst Ostpreußen die einzige Verbindung der Exklave mit dem Deutschen Reich. Der Seedienst Ostpreußen wurde 1939 nach dem Angriff auf Polen eingestellt.
Der Seedienst Ostpreußen war eine „politische Schiffahrtslinie, die nie Gewinn erzielte und doch florierte.“ (Kurt Gerdau)
Route und Schiffe
Anfänglich wurde der Seedienst mit gecharterten Schiffen privater Reeder, wie zum Beispiel von Erich Haslinger betrieben, später wurden reichseigene Schiffe eingesetzt. Als erstes Schiff verließ am 30. Januar 1920 das ehemalige Minensuchboot Hörnum der HAPAG den Hafen von Swinemünde in Richtung Pillau. Mit der Helgoland setzte die HAPAG ein weiteres gleichartiges Dampfschiff ein. Die Stettiner Reederei Braeunlich beteiligte sich mit dem Dampfschiff Odin, der Norddeutsche Lloyd aus Bremen setzte ab Juni 1920 den Tender Gruessgott ein.
Zunächst verpflichteten sich HAPAG und Braeunlich zu wöchentlich vier Fahrten. Später verkehrten die Schiffe im Sommer täglich nach einem festen Fahrplan gegen Garantie für eine Mindestanzahl von Passagieren, im Winter vier- bis fünfmal pro Woche zwischen Pillau bzw. Zoppot und Swinemünde. Im Jahr 1927 wurde die Strecke nach Nord-Osten bis Klaipėda/Memel und 1930 bis zum lettischen Libau verlängert. Ab 1933 fuhren die Schiffe im Westen bis Lübeck-Travemünde und ab 1934 bis Kiel.
Die anfangs eingesetzten Schiffe erwiesen sich als ungeeignet für die lange Fahrtzeit von 15 Stunden zwischen Swinemünde und Pillau. Die zu kleinen und wenig komfortablen Schiffe konnten mangels Schlafkabinen nicht für Nachtfahrten eingesetzt werden. Das Reichsverkehrsministerium kaufte daher verschiedene Schiffe, die durch unterschiedliche Reedereien betrieben wurden: 1926 wurden die Preußen (Reederei Braeunlich) und die Hansestadt Danzig (Reederei Norddeutscher Lloyd in Bremen) in Dienst gestellt.
Eingang zur Zitadelle v. Pillau
Im Zuge des Dreißigjährigen Krieges landete am 6. Juli 1626 der schwedische König Gustav Adolf mit einer Flotte von 37 Schiffen in Pillau, das anschließend von den Schweden zehn Jahre lang besetzt war. Sie bauten die schon vorhandenen Schanzen aus und errichteten die Festung Pillau. Während der Schwedenzeit vergrößerte sich der Ort, eine erste Kirche aus Holz wurde erbaut. Als 1635 die Schweden abzogen, baute der Große Kurfürst Pillau zum brandenburgischen Flottenstützpunkt aus. Dadurch wuchs die Bevölkerung erneut an, im Einzugsgebiet der Festung siedelten sich Lotsen, Händler und ehemalige Offiziere an.




1732 landen auf insgesamt 66 Schiffen die vertriebenen Salzburger in Pillau, sie finden in Ostpreußen eine neue Heimat.
1839 flüchtet Richard Wagner auf dem Pillauer Segler Thetis nach London, muß aber wegen furchtbaren Sturmes einen Fjord als Nothafen anlaufen. (Anregung zum Matrosenlied im "Fliegenden Holländer".
1842 wird die Seebadeanstalt gebaut.
1865 wird die Eisenbahn Königsberg - Pillau eröffnet. Anschluß an das russische Eisenbahnnetz erhöht den Verkehr. Der Staat hat 1864 (von der Königsberger Kaufmannschaft) die Verwaltung des Hafens übernommen. Die Nordmole wird 1883, die Südmole 1887 fertiggestellt. Der 26ha große Vorhafen wird in das Haff hinein vorgeschoben. Es wird ein besonderer Petroleumhafen angelegt.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts brachte die Industrialisierung neuen Aufschwung für die Stadt. Die in Pillau niedergelassenen Reeder verfügten 1848 über acht Handelsschiffe ( zum vergleich Danzig hatte in diesem Jahr 104 Handelsschiffe) Eine Eisenbahnlinie verband die Stadt ab 1865 mit Königsberg (60km), der Hafen wurde erheblich erweitert. Durch den Bau einer großen Kaserne wurde der Marinestandort weiter aufgewertet. Zu Beginn des 20. Jahrhundert wurde bei Pillau der Königsberger Seekanal durch das Haff fertiggestellt, der auch im Winter offengehalten werden konnte. Dadurch blieben fortan die Häfen Königsberg, Elbing und Braunsberg das ganze Jahr in Betrieb. Nach der Eingemeindung Alt-Pillaus und der Festung Pillau in die Stadt im Jahre 1902 wuchs die Bevölkerungszahl aufüber 7.000 an.



 1880 Die Segelregatten, die seit 1869 vom Segelclub "Rhe" nur vereinzelt stattfanden, werden seit 1880 regelmäßig vor Pillau abgehalten.
1880 Die Segelregatten, die seit 1869 vom Segelclub "Rhe" nur vereinzelt stattfanden, werden seit 1880 regelmäßig vor Pillau abgehalten.1904 wird die Infanteriekaserne gebaut, sie wird später Kaserne der V. Marine-Artillerie-Abtlg.
1914 werden mehrere Küstenbatterien gebaut und die Artilleriekaserne fertiggestellt. Die auf dem Schwalbenberg (1806) erbaute Landmarke wird unötigerweise(was war da wohl los??) gesprengt. Kreuzer "Pillau" macht viele Fahrten nach England und auch die Seeschlacht am Skagerak mit, nach dem Kriege nach Italien ausgeliefert, fährt der unter dem Namen "Bari" in der ital. Marine.
1920 Zur Volksabstimmung in Masuren kommen im Juli insgesamt 91000 Abstimmungsberechtigte über See durch Pillau, auf der Rückreise sind es noch einmal 50000. Des Korridors wegen wird ein Schnelldampfverkehr über Danzig - Swinemünde eingerichtet.
1921 wird Pillau wieder Marinestandort.
Trotz der Marine, Festung und Kriegswirren, war Pillau aber immer, auch ein sehr beliebtes Ausflugsziel, und Badeort der Königsberger Bevölkerung.
Pillau Wiki
http://de.wikipedia.org/wiki/Baltisk
Zeittafel Pillau
http://www.kreis-fischhausen.de/index.html?pillau/zeittafel.htm
Swinemünde Usedom
http://de.wikipedia.org/wiki/Swinem%C3%BCnde
Danzig
http://de.wikipedia.org/wiki/Danzig
28.12.2010
Bahnstrecke Berlin-Königsberg

Streckenkarte Berlin-Königsberg 1883!!
click for very high res
Die Strecke von Berlin über Königsberg nach Eydtkuhnen war mit 742,33 km die längste durchgehend kilometrierte Strecke der preußischen Staatsbahn (bis 1920) und der Deutschen Reichsbahn (1939 - 1945). Von 1920 bis 1939 war diese Kilometrierung durch die dazwischen liegende Strecke im polnischen Korridor unterbrochen.
Der Polnische Korridor war ein 30 bis 90 km breiter Landstreifen polnischen Territoriums, der zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Ostpreußen vom deutschen Kernland abtrennte, während er vorher zum Deutschen Reich gehörte. Der Korridor war keine politisch-historische Einheit; zwischen dem Polen zuerkannten Küstenabschnitt und der deutsch-russischen Grenze von 1914 lagen außer der bisherigen Provinz Westpreußen auch Teile des historischen Großpolen, unter der Hoheit Preußens und des Kaiserreichs Provinz Posen genannt. Die Bildung des Polnischen Korridors, der geographisch gesehen ein Zerschneidungskorridor war, wurde nach dem Ersten Weltkrieg am 28. Juni 1919 mit der Unterzeichnung des Vertrages von Versailles beschlossen. Die Übernahme der Gebiete durch Polen fand mit Inkrafttreten des Vertrags am 20. Januar 1920 statt.
http://www.eisenbahnsignale.de/Kilometrierung/Tabelle1/BerlinEydtkuhnen/Ostbahn1.htm


Hauptbahnhof Königsberg eröffnet 1929
Es ist unnötig zu beschreiben, daß dieser Bahnhof ausreichend Fahrkartenschalter besaß, Gepäckbereiche, Warteräume (schon damals auch für Nichtraucher) usw. Im Bahnhof war auch der Verkehrsverein untergebracht und ein Reisebüro, eine Buchhandlung und zwei weitere Läden.
Auch eine Poststelle befand sich im Bahnhofsgebäude, abgesehen davon lag das Postamt 5 nur in kurzer Entfernung westlich vom Bahnhof, mit diesem durch einen unterirdischen Tunnel verbunden.
Innerhalb des Gesamtgebäudes waren vier Höfe, die die Funktion von Lichthöfen hatten, davon profitierten z.B. die Warteräume. Eine große Küche im Erdgeschoß versorgte die Warteräume, die Warteräume für die 1. und die 2. Klasse hatten Restaurants. Toilettenanlagen befanden sich im Untergeschoß, dazu zwei Frisörgeschäfte, der Weinkeller des Restaurants und sogar eine Kegelbahn.
Imponierend waren natürlich die weitgespannten Bedachungen über den Gleisen, und wirklich praktisch die Gepäcktunnel unter dem Personentunnel. Von denen konnte das Gepäck mit Aufzügen zu den Bahnsteigen transportiert werden. In den weiten Räumen im westlichen Trakt befanden sich diverse Büroräume.
Am 19.09.1929 fand die feierliche Eröffnung des Betriebes auf den neuen Bahnanlagen statt. - Am 21.01.1945 ging der letzte von Flüchtlingen überfüllte Nachzug nach Berlin.
diese Infos und mehr
http://www.ostbahn.eu/html/konigsberg.html